Rechtsgeschichte mit dem Hammer geschrieben

Bundesjustizminister Heiko Maas plant eine Reform des Mordparagraphen. Ein alter Fall, der vor dem Landgericht Oldenburg verhandelt wurde, spielt dabei eine Rolle.
Foto: Markus Daams / flickr; Lizenz: CC BY 2.0
Oldenburg (Michael Exner) – Die von Bundesjustizminister Heiko Maas geplante Reform des Mordparagraphen hat (obwohl nur Teil des Pakets) die im § 211 des Strafgesetzbuches festgeschriebene lebenslange Freiheitsstrafe bei Mord erneut in den Blickpunkt gerückt. Die Debatte darüber ist so neu nicht – und das Landgericht Oldenburg hat vor mehr als 30 Jahren ein spannendes Kapitel mitgeschrieben.
Anzeige
Es ging um den sogenannten „Vareler Hammermord“, eine gleichermaßen griffige wie juristisch unkorrekte Bezeichnung (weil am Ende kein Mordvorwurf blieb). Es war ein spektakulärer Fall, den der Rechtsanwalt und Autor Ferdinand von Schirach erst vor einem Jahr in seiner Verbrechen-Serie für das ZDF leicht verfremdet geschildert hat. In der friesländischen Stadt hatte im Spätsommer 1982 eine Frau ein Ehemartyrium blutig beendet. Die damals 36-Jährige war wie ihr Sohn aus erster Ehe über Jahre vom trunksüchtigen Ehemann schwer misshandelt worden, wollte die Familie aber wegen ihres pflegebedürftigen Vaters nicht verlassen. Nach erneuter Misshandlung und erzwungenem Sex fürchtete die Frau um das Leben ihres Sohnes, dem der Stiefvater für den nächsten Tag Prügel „bis zum Verrecken“ angedroht hatte. In der Nacht erschlug sie ihren schlafenden Mann mit dem Hammer.
Den Oldenburger Richtern war klar, dass da nicht die klassische Mörderin im Sinne des § 211 vor ihnen stand. Andererseits wog der Tod im Schlaf juristisch gesehen schwer. So lastete die Schwurgerichtskammer der Frau Heimtücke (klassisches Mordmerkmal) an, verneinte verminderte Schuldfähigkeit und verurteilte sie wegen Mordes. Anstelle des gesetzlich vorgeschriebenen „Lebenslang“ verhängte die Kammer jedoch eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Damit wollten die Richter einen Ausweg beschreiten, den der Bundesgerichtshof (BGH) zwei Jahre zuvor eröffnet hatte.
Dessen Großer Strafsenat hatte 1981 in einer nicht minder spektakulären Entscheidung erstmals die Automatik Mord=Lebenslang gekippt. In dem als „Türken-Urteil“ (würde man heute auch nicht mehr so formulieren) in die Geschichte eingegangen Fall hatte die Justiz ein Familiendrama unter türkischen Staatsangehörigen aufgearbeitet. Dabei hatte ein Mann die Ehefrau seines Neffen mit vorgehaltener Pistole vergewaltigt, sich später vor dem Mann des verzweifelten Opfers (mehrere Freitodversuche) mit der Tat gebrüstet und auch den mit dem Tod bedroht. Der Neffe ging erst nach Hause, sagte zu seiner Frau „Ich werde ihn umbringen, wenn ich ihn treffe“ und erschoss den Onkel dann von hinten, als der in einem Lokal beim Kartenspiel mit Freunden saß. Der BGH hob das im ersten Durchgang auf Lebenslang lautende Urteil auf und prägte einen neuen Leitsatz: Bei Fällen heimtückischer Tötung ist zwar weiterhin wegen Mordes zu verurteilen. Die Strafe kann aber (nach § 49 des Strafgesetzbuches „Besondere gesetzliche Milderungsgründe“) gemildert werden, wenn wegen „außergewöhnlicher Umstände“ die „Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe als unverhältnismäßig erscheint“.
Mit diesem Spruch im Rücken glaubten sich die Oldenburger auf der sicheren Seite – und wurden postwendend von einem BGH-Strafsenat bei der Aufhebung des Urteils belehrt, sie hätten es sich zu einfach gemacht. Wenn eine Tat „ihren Grund in dem tyrannischen, die Familie unerträglich quälenden, Furcht und Schrecken einflößenden Verhalten des Opfers“ habe, müsse ein Schwurgericht die Voraussetzungen der Heimtücke „besonders sorgfältig prüfen“ und alle in Betracht kommenden Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe erschöpfend abhandeln, hieß es in der Begründung. Keineswegs hätten die Richter „voreilig auf die sogenannte Strafzumessungslösung ausweichen“ dürfen. Experten kommentierten damals die Entscheidung so: „Der 5. Strafsenat versucht, die Geister zu vertreiben, die der Große Senat gerufen hatte.“
Die Oldenburger murrten leise, studierten die Begründung, griffen „ein paar Tipps“ auf, „die uns der BGH gegeben hat“, verurteilten die Frau bei der Neuauflage im Februar 1985 wegen Totschlags bei verminderter Schuldfähigkeit zur Mindeststrafe von zwei Jahren und setzten die zur Bewährung aus. Damit war der Vareler Fall beendet, nicht aber die Debatte um Mord und Lebenslang.
Der Mord-Paragraph und seine Eigenheiten
Der § 211 (Mord) des Strafgesetzbuches hat folgenden Wortlaut: „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.“
In der Debatte um die Reform spielen vor allem zwei Argumente eine Rolle. Ein politisches: weil der Paragraph in dieser (bis heute kaum veränderten) Form 1941 von den Nationalsozialisten unter Federführung des Volksgerichtshofpräsidenten Roland Freisler formuliert wurde – nur dass anstelle der lebenslangen Freiheitsstrafe dort die Todesstrafe stand. Und ein rechtssystematisches: weil der Paragraph von seiner Struktur her völlig aus dem Rahmen des Gesetzbuches fällt. Beide Argumente hängen im Hintergrund zusammen.
Normalerweise benennt das Strafgesetzbuch einen Tatbestand, definiert ihn dann und setzt danach den Strafrahmen fest. Beispiel: „§ 242 Diebstahl. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Es ist also ein Tatstrafrecht. Bis 1941 galt das auch für den Mord, für den das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 vorsah: „§ 211. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft.“ Das entsprach noch der üblichen Systematik.
Die 1941er Version wechselt in diesem (und nur in diesem) Paragraphen zum Täterstrafrecht. Freisler konstruiert einen Tätertypus, den „Mörder“, der sich bei Bedarf problemlos etwa durch den „Volksschädling“ ersetzen lässt. Gälte diese Täterkonstruktion auch in anderen Bereichen, müsste es zum Beispiel heißen: „Der Betrüger wird …“. Heißt es aber nicht, sondern: „§ 263 Betrug. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird …“. Der Unterschied ist offenkundig.
Mit der absoluten Strafandrohung „Lebenslang“ hat das alles zunächst nichts zu tun. Dahinter hatte das Bundesverfassungsgericht schon 1977 ein Fragezeichen gesetzt mit seiner Entscheidung, der § 211 „ist verfassungsmäßig, wenn dem Verurteilten (über die Aussicht auf Begnadigung hinaus) die Möglichkeit einer Strafaussetzung verbleibt“. Der Bundesgerichtshof hat daran in seiner Entscheidung von 1981 angeknüpft, nach der auch bei Mord ein „lebenslänglich“ unverhältnismäßig erscheinen kann. Seit diesem Zeitpunkt ist die Diskussion nie ganz verstummt, wie man den Gerichten im Einzelfall aufwendige „Umgehungskonstruktionen“ in der Begründung ersparen kann.

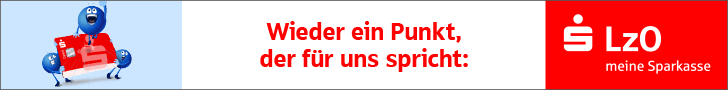




Keine Kommentare bisher